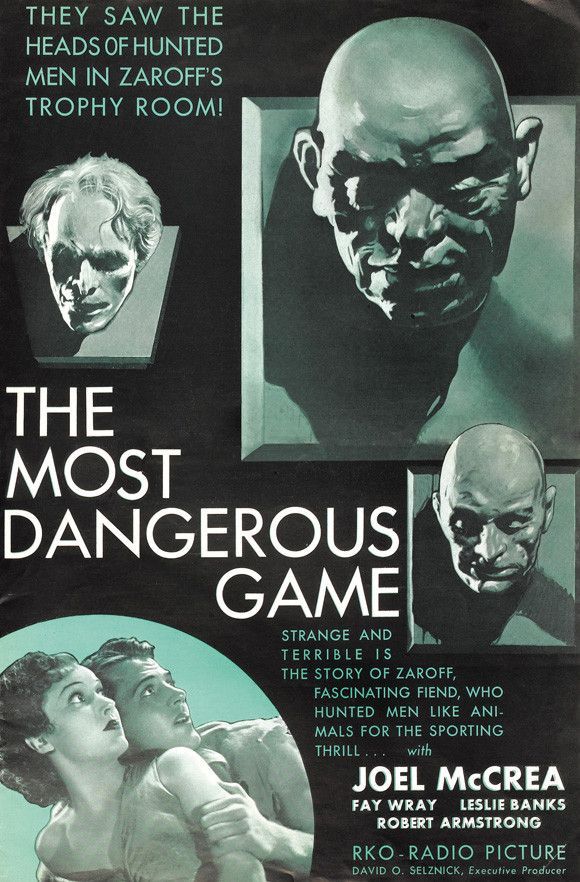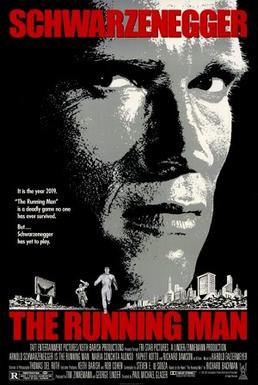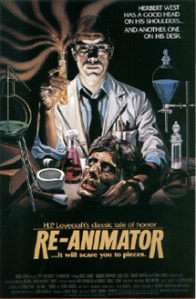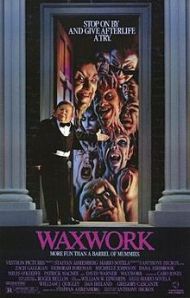Monster haben Geschmack. Sie fressen nicht alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Nein, sie wählen ihre Opfer gezielt aus. Horrorfilme lieben den Kontrast. Daher setzen sie der hässlichen Kreatur eine schöne Frau gegenüber. Die Schöne und das Biest dient als Grundmotiv für jeden Konflikt, der sich innerhalb des Horrorgenres abspielt. Die Vertreterinnen der Genderstudies sehen darin gerne sexistische Motive. Aber wahrscheinlich sind sie nur neidisch, da nicht sie es sind, die der Kiemenmensch auf seinen starken Armen davon trägt. Der Kontrast zwischen schön und hässlich führt gelegentlich zu Produktionen, in denen Schönheit verbunden wird mit rein materialistischen Werten. Diese dienen als Grundlage für heimliche Satiren auf das Geschäft mit der Schönheit. Der koreanische Horrorfilm „Yoga“ (2009) wäre dafür ein geeigntes Beispiel. Darin geht es um eine Gruppe junger Frauen, die innerhalb weniger Tage mithilfe von Yogaübungen ihre Traumfigur erreichen wollen. Dies ist jedoch verbunden mit einem gemeinen Wettbewerb. Der Leser kann sich sicherlich denken, dass der Kampf um die Schönheit recht blutig wird.
Noch direkter werden Filme, in denen die Hauptfiguren Fotomodels sind, die nach und nach Opfer einer hinterhältigen Kreatur werden. Man könnte hier beinahe von einem Subgenre sprechen, wenn es nicht so wenig Filme geben würde, die exakt diese Figurenkonstellation aufweisen. Im Folgenden möchten wir drei Beispiele diese Filmkost vorstellen:
Bekanntlich produzierte man in Deutschland in den 60er Jahren noch unterhaltsame Filme. In der Tat kommt so manche Trash-Granate aus jener Zeit aus Deutschland bzw. wurde von deutschen Produzenten mitfinanziert. So auch der Streifen „Ein Toter hing im Netz“, dessen internationaler Verleihtitel „Horrors of Spider Island“ lautet. Der Film kam 1960 in die Kinos und handelt von einer Gruppe Fotomodels, die für ein Shooting nach Singapur gebracht werden sollen. Doch das Flugzeug stürzt ab und die jungen Frauen können sich gerade noch auf eine einsame Insel retten. Das heißt, so einsam ist es dort nicht. Ihre Gastgeber sind mutierte Riesenspinnen. Diese haben Fotomodels besonders gern… Wie auch die späteren Karl Mai-Filme, so wurde „Horrors of Spider Island“ (auch bekannt unter dem Titel „It’s hot in Paradise“) in Yugoslavien gedreht.
1974 kaperten Amando de Osorios berühmte reitenden Leichen ein altes Segelschiff. Unsere FSKler machten mit dem Film kurzen Prozess und beschlagnahmten ihn. Das Verbot gilt bis heute, auch wenn einmal mehr die Gründe dafür nicht nachvollziehbar sind. In dem dritten Teil der Quadrologie um spukende Tempelritter mit dem Titel „Das Geisterschiff der reitenden Leichen“ (alternativ gibt es auch den Titel „Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen“) geht es um zwei Fotomodels, die Werbung für ein neues Motorboot machen sollen. Dafür werden sie mit dem Boot im Meer ausgesetzt, in der Hoffnung, von einem Schiff gerettet zu werden und dadurch Schlagzeilen zu machen. Etwas kompliziert, um Werbung für das Boot zu machen, aber bitte. Jedenfalls hält tatsächlich ein Schiff auf sie zu. Doch handelt es sich dabei um keinen erhofften Luxusliner, sondern um ein altes Segelschiff. Kaum an Bord, machen die Models auch schon die unangenehme Bekanntschaft mit den reitenden Leichen.
1981 erblickte die Produktion „Dawn of the Mummy“ das Licht der Welt. Es handelt sich dabei um den einzigen Mumienfilm, in dem die Mumien kanibalistische Gelüste zeigen. Hauptfiguren sind einmal mehr eine Gruppe Fotomodels. Diese reisen für ein Shooting nach Ägypten, wo sie zwischen den Pyramiden ein paar Werbeaufnahmen machen sollen. Dabei stoßen sie auf ein neu entdecktes Grab. Der Fotograph entscheidet sich dafür, das Shooting im Grab weiter zu führen. Natürlich eine fatale Fehlentscheidung. Denn dort ist gerade eine Mumie zum Leben erwacht und hat es nun auf die Models abgesehen.
In Frank Agramas Trash-Klassiker bleibt es nicht bei einer einzigen Mumie. Nach und nach gesellen sich weitere Untote dazu, um ordentlich auf den Putz zu hauen. Es ist wirklich erstaunlich, dass dieser Film im Grunde genommen eine Mischung aus Mumien-, Zombie-, Vampir- und Kannibalenfilm ist. Agrama gelingt es dadurch, das verstaubte Image des Mumienfilms (eine der letzten Hammer-Produktionen aus den 70er Jahren beschäftigte sich ebenfalls mit wieder erweckten Mumien und ging, trotz interessanter Story, baden), aufzupolieren und den damaligen Trends, welche vom US-Slasher-Film und den italienischen Horrorfilmen bestimmt wurden, anzugleichen.
Dies gelang erst zwei Jahrzehnte später erneut mit dem Remake des Boris Karloff-Klassikers „The Mummy“ (1999). Nur mit dem Unterschied, dass man in dieser Produktion auf Action, Abenteuer und Witz setzte, also den damaligen (und eigentlich bis heute geltenden) Stilelementen (Tom Cruise als Mumienschreck lassen wir mal beiseite). Ein weiterer Unterschied: es fehlen die Fotomodels.